E-Learning Strategien im tertiären Bildungswesen
Prof. Dr. Johann Günther
Generelle Trends im europäischen Bildungssystem
Unsere Welt wurde in den letzten Jahrzehnten global. Überall auf der Welt ähnelt sich das Verhalten. Die Weltwirtschaft setzt Maßstäbe, die überall gleich sind.
Davon wurde jetzt auch das Bildungssystem getroffen. Im Liberalismus unserer Zeit regiert die Wirtschaft und wirtschaftliches Denken. Bildungsminister haben den Begriff Employability geformt und wollen junge Menschen ausbilden, dass sie sofort und ohne weitere Zusatzeinschulung in wirtschaftlichen Positionen verwendbar sind. Universitäten sind nicht mehr die großen und freien Denkeinrichtungen. Sie wurden ihrer Freiheit beraubt und werden am Output gemessen. Ihre Absolventen müssen rasch und schnell im Arbeitsmarkt vermittelbar sein. Das österreichische Arbeitsmarktservice AMS gibt Statistiken heraus, die sogar zeigen, von welcher Universität und von welcher Hochschule wie viele Absolventen arbeitslos gemeldet sind. Eine Hitparade der Employabilität entstand. Aus Sicht der Politik ist nicht das vermittelte Wissen und die erzielten Abschlussresultate ausschlaggebend, sondern die Vermittelbarkeit der Jugendlichen als Arbeitskräfte.
Die zunehmende Internationalität machte eine Anpassung des Bildungssystems notwendig. Junge Menschen arbeiten in anderen Ländern und anderen Kontinenten. Ihre akademischen Abschlüsse müssen vergleichbar sein. Personalchefs in Amerika müssen ein europäisches oder australisches Abschlusszertifikat einstufen können.
Demnach wird ein weltweit einheitliches System im tertiären Bildungswesen angestrebt. Die Europäische Union wechselt zum anglo-amerikanischen System, das eine Dreistufigkeit mit
- Bakkalaureat,
- Master und
- PhD
vorsieht.
Auch die Zeiten werden angeglichen und mit der Formel „3 – 2 – 3“ definiert:
3 Jahre für das Bakkalaureatsstudium,
2 Jahre für die Ausbildung zum Master und
3 Jahre für das Doktorat, das PhD.
Die Umstellung ins dreistufige Bildungssystem bringt für Europa einen unteren Layer, den es bis jetzt nicht gegeben hat. Dadurch werden Bildungsinstitutionen, die bis dato nicht akademisch bezeichnet wurden „undergraduats“. Einrichtungen wie Militärakademien, Pädagogische Akademien, Gesundheitsakademien oder Sozialakademien werden Hochschulen und schließen zumindest mit dem Bakkalaureat ab.
Dies bringt eine zusätzliche Zahl von Akademikern, die von der österreichischen Regierung noch nicht als Akademiker anerkannt werden.
Österreich hat acht Millionen Einwohner. Vier Millionen Österreicher sind im Arbeitsprozess. Durch das Älterwerden der Gesellschaft nehmen – wenn es zu keinen Anpassungen kommt – die Erwerbstätigen ab:
2000 2050
Summe Einwohner 8,1 8,2
3. Generation (ab 60 Jahre) 1,7 2,9
2. Generation (bis 60 Jahre) 5,0 4,2
1. Generation (bis 15 Jahre) 1,4 1,1
Erwerbstätige 3,7 3,1
Deckungslücke 1,4
Quelle: Statistik Österreich
Angaben in Millionen Einwohner Österreichs
Unabhängig von dieser Veränderung gibt es in Österreich derzeit 300.000 Menschen mit akademischem Abschluss.
Durch das neue Bildungssystem mit Bakkalaureatsabschluss wird dieser Anteil zunehmen.
Die Studentenanzahl an Universitäten stagniert:
WS 2000 WS 2003
Österreicher 193.649 155.861
Ausländer 27.856 29.577
Scource: Statistisches Taschenbuch 2004, BMBWK
Privatisierung und Liberalisierung
Die öffentlichen Leistungen werden auf Grund veränderter Bedingungen neu definiert. Die geänderten Bedingungen entstanden auf Grund:
· der geänderten Weltwirtschaft,
· Globalisierung,
· Österreichs Mitgliedschaft in der EU,
· gewachsenem Wohlstand,
· demographischen Änderungen und
· Budgetbeschränkungen des Staates.
Österreich strebt politisch die Weiterentwicklung des Staates zu einem effizienten und solidarischen Dienstleistungsstaat an.
Durch die fortschreitende Globalisierung ist es für einen einzelnen Nationalstaat nicht mehr möglich alleine regulierend einzugreifen. Ein gemeinsames Vorgehen innerhalb der Europäischen Union ist unumgänglich. Die wirtschaftspolitische Kompetenz geht vom Nationalstaat auf die EU über.
Die grenzüberschreitende Problematik wurde im Studienjahr 2005/06 mit einer Unzahl von deutschen Staatsbürgern im österreichischen Medizinstudium bewusst gemacht. Belgische Universitäten haben in manchen Fachrichtungen mehr französische als belgische Studierende. Der Nationalstaat Belgien zahlt für die Ausbildung der Franzosen. Die österreichischen Steuerzahlen müssen für die medizinische Ausbildung vieler Deutscher auskommen.
Dies bedarf internationaler Regulierungen.
Noch extremer wird diese Situation im Bereich der Fernlehre, die mit Zunahme von Telekommunikation und Internet auch gewachsen ist.
Das Bildungssystem wird von der Politik zunehmend mit wirtschaftlichen Kriterien behandelt. Im tertiären Bildungswesen wurde bereits bei der Gründung das Fachhochschulwesen als privatwirtschaftliche Institution eingerichtet. Hochschulen sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Firmen, die nicht mit Waren, sondern mit Ausbildungsprogrammen handeln.
Daneben wurde dieser bereich liberalisiert. Jeder konnte sich um eine „Lizenz“ bewerben. Eine Überwachungskommission sorgt für staatlich genormte Standards.
Liberalisierung in der Wirtschaft hat lange Tradition. Bereits Kaiserin Maria-Theresia und ihr Nachfolger Josef II schufen für die Donaumonarchie eine günstige wirtschaftliche Ausgangslage indem sie vieles liberalisierten. Dem schadeten auch die folgenden Gegenreformationen nicht.
Dieser Liberalisierungsprozess setzte sich in der Zulassung von privaten Universitäten fort und erreichte mit dem Universitätsgesetz … und der so genannten „Autonomie“ der Universitäten ihren Höhepunkt.
So haben wir heute in Österreich private, öffentliche und staatliche Universitäten und Hochschulen nebeneinander.
Das Akkreditierungssystem und die laufende Evaluierung überprüfen aber unterschiedliche Fakten.
· Fachhochschulen: laufende Überprüfung der einzelnen Studienprogramme und einmalige Akkreditierung ohne weitere Prüfungen als Institution.
· Privatuniversitäten: Akkreditierung als Institution. Studienprogramme werden nicht mehr akkreditiert oder überprüft. Laufende Evaluierung der Institution.
· Staatliche Universitäten: werden nicht evaluiert oder akkreditiert.
Gesetzlich wurde zwar eine freie Marktwirtschaft des tertiären Bildungswesens geschaffen, praktisch werden die einzelnen Bereiche aber mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen, und es kommt zu einer Beeinflussung der freien Marktregeln.
Staatliche Universitäten sind zwar einerseits „autonom“, Zielvereinbarungen des zuständigen Ministeriums mit der Universitätsleitung definieren und bestimmen aber die Ausbildungsgebiete und deren Umfang.
Fachhochschulen, die einerseits privatwirtschaftlich geführt sind, werden vom Staat mit einer vorab definierten Studienprogrammsteilnehmerzahl subventioniert. Pro Studierenden bekommt die Hochschule einen bestimmten Studienbeitrag.
Outputorientierung
Die Wirtschaft stellt zunehmend von Input-Orientierung zu Outputorientierung um.
Inputorientiert wurde die Arbeitsleistung in Zeit gemessen. Arbeitskräfte bekommen für ihre Anwesenheitszeit bezahlt und nicht für die Produktion.
Outputorientierte Bezahlung bedeutet, dass nur mehr jene Leistung bezahlt wird, die erbracht wurde.
Arbeitsaufträge werden in einer Zieldefinition festgelegt und in welcher Zeiteinheit dieses Ziel erreicht wird, ist für die Bezahlung nicht mehr relevant.
Rasch arbeitende Menschen werden dadurch besser bezahlt als langsame. Im Wissensmanagementbereich sind schlaue und gescheite Arbeitnehmer besser bezahlt. Ihr Zeitaufwand, um ein bestimmtes Ziel, eine festgelegte Aufgabe zu erfüllen, ist kürzer.
Im Bildungssystem kommt es zu einer ähnlichen Veränderung.
Lehrleistung wurde und wird in Semesterwochenstunden, also in Lehreinheiten definiert. Gemessen werden jene Stunden, die ein Vortragender „vorliest“, vorträgt.
Derzeit wird die Messeinheit auf ECTS - European Transfer Points – umgestellt. Diese haben nicht nur den Zweck, dass Lehrleistung international anerkannt wird und die Studierenden ihre erworbenen Vorlesungen auch in andere Länder und an andere Universitäten mitnehmen können, sondern, dass Vorlesungen nicht mehr in Vorlesungseinheiten, sondern in Lernaufwandeinheiten festgelegt werden.
Ein ECT-Point drückt den Zeitaufwand, den ein durchschnittlicher Studierender zum Erwerben einer bestimmten Lehreinheit aufzuwenden hat, aus. Das inkludiert die Vorlesungszeit durch den Lehrer und die Zeit des Studiums und des Wiederholens des Lehrstoffs.
Vier ECTS Punkte können bestehen aus einer einstündigen Vorlesung, zu der noch drei Stunden selbst gelernt werden muss. Es kann aber auch eine vierstündige Vorlesung sein, die keinerlei Wiederholung bedarf.
Erst mit den ECTS Punkten kann E-Learning und Fernlehre gewertet werden. Im Bereich der Fernlehre kann es ECTS-Punkte ohne Präsenzlehrstunden geben.
Diese outputorientierte Messung von Lehre bringt mehrere Vorteile:
· die Internationalisierung wird erleichtert; Lehreinheiten sind transportabel und werden von allen tertiären Bildungseinrichtungen Europas anerkannt,
· rasch lernende Studierende bekommen für wenig Zeitaufwand mehr ECTS-Punkte; schwache Schüler müssen mehr Zeit aufwenden;
· Fernlehre wird messbar und ist voll vergleichbar mit Präsenzunterricht.
Strategieprozess
All diese Veränderungen im europäischen und österreichischen Bildungssystem führen zu einem starken wirtschaftlichen Einfluss an Universitäten und Hochschulen und einer ökonomischen Ausrichtung.
Diese wirtschaftorientierte Führung der tertiären Bildungseinrichtungen macht auch die Entwicklung von Strategien – wie in Unternehmen – notwendig.
Der Prozess zur Entwicklung einer eigenen Strategie hat mehrere Stufen:
·
Werte
In der ersten Stufe muss ein Wertesystem für das
Unternehmen eingerichtet werden. Werte, unter denen man kommuniziert.
Kommuniziert mit den Studierenden, aber auch untereinander im Personalbereich.
Wertesysteme sind die Basis für ein Zusammenarbeiten in der
Bildungseinrichtung.
·
Positionierung des Instituts
Mit diesen Werten kann das eigene
Bildungsunternehmen im Markt der Anbieter positioniert werden und kann sich auf
der Werteebene unterscheiden.
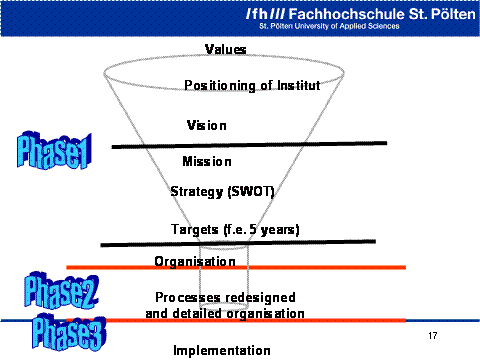
·
Vision
Basierend auf den Werten kann eine Vision
erarbeitet werden. Eine Vorstellung, ein Ziel, wo man in einigen Jahren – 5
oder 10 Jahren – stehen möchte.
Die Vision soll so visionär angesetzt werden, dass sie erreichbar ist, aber
doch ein hehres Ziel ist. Etwas, das man unter großen Anstrengungen erreichen
kann.
·
Mission
Die Mission drückt aus, wie sich das Unternehmen
selbst versteht, wozu es existiert und was ihre Ziele sind.
·
Strategie
Erst nach Festlegung der vorgenannten Werte kann es
zur strategischen Positionierung kommen. Was will man erreichen? Was ist
erreichbar? Wie kann man es erreichen? Wo sind die Stärken? Wo sind die
Schwächen?
·
Targets
Sind Teil der Strategie. Die Vision wird in
quantitativen Werten ausgedrückt. Zum Beispiel, wie viele Studierende die
Einrichtung in fünf Jahren haben wird.
·
Organisation
Um die gesetzten Ziele zu erreichen, muss eine
Organisation definiert werden, die diesen Ansprüchen entspricht.
·
Implementierung
In der letzten Phase, der Phase 3, erfolgt die
Umsetzung, die Implementierung.
Zur Positionierung gibt es drei Möglichkeiten:
- Produktorientierung
- Kostenorientierung oder
- Kundenorientierung
Wobei in jeder Orientierungsform ein Mindestmaß erreicht werden muss. Die Marktmittelwerte sollte die Bildungseinrichtung in jedem Fall erreichen. In einer muss es aber zu einer klaren Ausprägung kommen.

In der Produktorientierung muss man der technologische Führer sein. Der beste Ausbildner. Die führende Bildungseinrichtung auf Grund der Ausbildner und deren Niveau und auf Grund der vorhandenen Infrastruktur. Es ist eine elitäre Bildungseinrichtung, deren Zugang für Studierende schwierig ist und wo nur die besten genommen werden.
Die Kostenorientierung versucht mit niedrigen Aufwendungen und wenig Ressourcen ein Höchstmaß an Output zu produzieren. Alle Maßnahmen sind aber von der Kostenfrage getrieben. Im Bildungswesen entsteht eine Massenuniversität. Ein Vortragender kostet für 100 Studierende gleich viel als für 500 und der Kostenfaktor reduziert sich auf ein Fünftel.
Die Kundenorientierung versucht in einem partnerschaftlichen Verhältnis und guter Betreuung jedes einzelnen Studierenden ein Maximum an Output zu erzielen. Die Bildungseinrichtung hat zwar nicht den letzten Stand der Technik in ihren Labors; unter den Vortragenden befinden sich keine Stars der Szene, aber mit viel Engagement und persönlichen Kontakt zu jedem Studierenden versucht man das Ergebnis individuell hoch zu halten. Jeder wird zu seinem Ziel geführt.
Diese Positionierung ist die erste strategische Entscheidung. Im wissenschaftlichen Personal wird immer zuerst die Produktführerschaft angestrebt. Jeder will der beste in der Branche sein. Jeder will zu den Führenden gehören. Rasch kommt aber die Einsicht, dass dies auch finanzielle und sonstige Ressourcen erfordert, die oft nicht vorhanden sind.
Die Kostenorientierung erscheint ebenso im ersten Eindruck als die am wenigsten anstrebenswerte. Es wirkt wie Diskont- oder Billigausbildung. Niemand will in einer billigen Einrichtung arbeiten. In einer Einrichtung, die sich nur und fast ausschließlich nach den Kosten richtet. Selbst die Entscheidung nach bestimmten Studienrichtungen würde nach der erforderlichen Einrichtung getroffen werden. Aufwendige technische Studien kommen wegen der teuren Labors nicht in Frage. Es gibt solche Bildungseinrichtungen – auch in Österreich -, nur werden sie im ersten Eindruck nicht gleich wahrgenommen. Erst bei genauerer Analyse lässt sich dann feststellen, was angeboten wird und wie.
Kundenorientierung bedarf eines höheren Personalaufwands. Es muss genug Professoren und Assistenten geben, um den individuellen Betreuungsmaßnahmen nachkommen zu können. In einer kundenorientierten Universität haben die Professoren keine Sprechstunden. Sie sind für Studenten immer erreichbar.
Beispiele aus der Wirtschaft sollen ein Gefühl für die Positionierung und deren Außenwirkung geben:
Vision
Die Vision ist das Bild der Zukunft in 5 bis 10 Jahren, das aussagt, wie das Unternehmen, die Organisation, anders sein wird:
– Anders, als es jetzt ist
– Anders, als die Anderen heute sind
– Anders, als die Anderen in der Zukunft sein werden
– Anders durch das Brechen von Regeln
– Anders durch das Neuerfinden der Branche oder zumindest durch das Regenerieren der Strategie
Das abstrakte Denken fehlt oft. Neuerungen können nicht aus der Vergangenheit abgeleitet werden. Exploratives Marketing ist notwendig. Keine Weiterrechnung der Vergangenheit, sondern neue Ansätze, die auch mit bestehenden Regeln brechen.
Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass andere Bildungseinrichtungen, andere Organisationen, einen ähnlichen Prozess eingehen. Nur den Iststand der Mitbewerber zu überholen ist zu wenig.
Umsetzungsschritte
Im Nachfolgenden soll ein Acht-Schritte Modell zur Umsetzung angeboten werden.
Ein Muster, wie man die Vision und Strategie in der Organisation einbringen kann.
Von der Belegschaft kann davon ausgegangen werden, dass etwa
- 1/3 Pioniere sind, die Neuerungen rasch annehmen und bei deren Umsetzung auch mitarbeiten,
- 1/3 Follower sind – Mitarbeiter, die dem ersten Drittel, den Opinionleadern folgen und nur etwa
- 1/3 sind für Neuerungen nicht bekehrbar. Hier müssen Lösungen gefunden werden, sie in den neuen Prozess mit ihren alten Ansichten zu integrieren.
- Schritt
Bewusstsein zur Umsetzung schaffen
Den Mitarbeitern des Unternehmens muss die Dringlichkeit einer Veränderung bewusst gemacht werden.
Durch das Prüfen der Markt- und Wettbewebsrealitäten kann die Dringlichkeit der Veränderung festgestellt werden.
Die reale und potentielle Krisen oder große Chancen sollen identifizieren werden, um sie dann mit den Entscheidungsträgern der Organisation zu diskutieren.
- Schritt
Opinionleadergruppe for men
Neben der Leitung des Bildungsunternehmen – das Rektorat oder die Geschäftsleitung – muss eine Gruppe veränderungsbereiter Mitarbeiter geschaffen werden, die den Prozess begleiten und als Multiplikatoren in die ganze Organisation strahlen. Koalitionen müssen geschaffen werden, um die Organisation mit all ihren Interessensvertretungen auf eine einheitliche Ausrichtung zu einigen.
Das Bilden einer genügend starken Gruppe, die den Veränderungsprozess anführt. Die Mitglieder müssen aus jenen Mitarbeitern rekrutiert werden, die zu den Pionieren gehören. Sie beschleunigen den Umsetzungsprozess. Ein Mitglied aus den nicht zur Veränderung bereiten verlängert die Einführungsphase.
Die Mitglieder der Führungsgruppe müssen als Team agieren und dürfen nicht aus nebeneinander stehenden Einzelkämpfern bestehen.
- Schritt
Vision definieren
Damit die Veränderung eine zielorientierte Ausrichtung bekommt, muss eine Vision geschaffen werden. Die Vision muss das gemeinsame Ziel für alle Mitarbeiter der Organisation sein.
Strategien sollen dann die gesetzte Vision umsetzen.
Die Vision ist das Ziel, das man erreichen will.
Zielorientierte Organisationen und mit Visionen ausgestattete Mitarbeiter sind erfolgreicher als orientierungslose.
- Schritt
Publizieren der Vision
Die Vision muss einfach abgefasst, einfach verständlich formuliert sein. Die Vision muss von allen Mitarbeitern der Organisation verstanden werden. Sie muss lückenlos an alle – auch an externe Partner – kommuniziert werden.
Um dies umzusetzen, sollen alle verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten angewendet werden.
Die Vision und Strategie muss von allen verstanden werden. Daher ist der Kommunikationsprozess ein sehr wichtiger.
Man kann die entwickelten Visionen und Strategien an der Opinionleader Gruppe gut testen. Die Verhaltensweise sollte an dieser Gruppe genau beobachtet werden und eventuell in einer Feed Back Schleife noch eingearbeitet werden.
Erst dann kann die gemeinsam definierte Vision überzeugungsgerecht von allen Multiplikatoren kommuniziert werden.
- Schritt
Vision leben
Die Vision ist eine theoretische Definition. Sie muss in der Praxis, im täglichen Leben, umgesetzt werden. Die Mitarbeiter müssen angehalten oder auch ermächtigt werden, nach ihr zu leben.
Hat sich die Organisation für ein partnerschaftliches, kundenorientiertes Zusammenarbeiten entschieden, sind autoritäre Entscheidungen abzulehnen und in einen demokratischen Entscheidungsprozess zurückzuführen.
Mitarbeiter, die nicht nach den Visionen und ihren Werten handeln, sind ebenso zur Rechenschaft zu ziehen wie Mitarbeiter, deren Arbeitsleistung nicht stimmt.
Oft sind Hindernisse, um zum Ziel zu kommen, zu überwinden. Nicht alle Mitarbeiter sind bereit, diese Zusatzenergien aufzubringen. Unterminierungen sind aber zu ahnden, damit der Veränderungsprozess nicht gefährdet wird.
Speziell die Pioniere sind darin zu bestärken, dass sie nichtkonventionelle Ideen umsetzen, neue Aktivitäten in Angriff nehmen und Mut zum Risiko haben.
Von neun Dingen, die im täglichen Leben gemacht werden, stellen sich im Nachhinein sechs als falsch heraus. Fehler zu vermeiden heißt also, weniger zu tun. Der prozentuelle Anteil der Fehlentscheidungen bleibt aber unverändert.
Veränderungsprozesse brauchen auch Fehlentscheidungen und sofortige Korrekturen.
- Schritt
Kurzfristige Erfolge
Kurzfristige Erfolge zum Ziel bringen Motivation für die Mannschaft. Sind Erfolge zu weit in die Zukunft verlegt, geht die Bereitschaft am Überwinden von Schwierigkeiten verloren.
Kurzfristige Erfolge sind notwendig.
Kurzfristige Erfolge müssen ebenso geplant und geschaffen werden wie langfristige.
Mitarbeiter, die kurzfristige Erfolge erreichen, sollen öffentlich belohnt werden. Diese Anerkennung bringt Vorbildwirkung und erstrebenswertes Ziel für die gesamte Organisation.
- Schritt
Konsolidierung
Die Konsolidierung des Veränderungsprozesses stellt immer wieder eine neue Basis für weitere Veränderungen dar. Der Veränderungsprozess bringt eine starke Verunsicherung für die Mannschaft. In bestimmten Abschnitten zu konsolidieren bringt wieder eine sichere Basis.
Diese neue Basis bringt wieder mehr Glaubwürdigkeit in jene, die die Ziele vorgeben.
Nach jeder Konsolidierung muss unmittelbar ein weiterer Veränderungsprozess mit neuen Teilzielen, neuen Projekten, neuen Themen und neuen Veränderungsagenden folgen.
- Schritt
Institutionalisierung
Wirklich implementiert sind eine Vision und eine Strategie, wenn allen Mitarbeitern der Zusammenhang zwischen dem Unternehmenserfolg und dem geplanten Verhalten durch die Werte, den gesetzten Zielen, durch die Vision und den quantitativen Vorgaben durch die Strategie klar und bewusst ist.
Die Leadershipfunktion des Opinionleaderteams muss aber weiter gehen. Vielleicht ändert sich die Zusammensetzung des Teams, aber die Vision bedarf einer roulierenden Neudefinition. Ziele müssen in der Zukunft aufgehängt sein und dürfen nicht in die Vergangenheit zurückfallen.
So betrachtet ist der Visions- und Strategieprozess ein nie endender.
Vision
Die Vision ist das Bild der Zukunft in 5 bis 10 Jahren, das aussagt, wie das Unternehmen, die Organisation anders sein wird:
– Anders, als es jetzt ist
– Anders, als die Anderen heute sind
– Anders, als die Anderen in der Zukunft sein werden
– Anders durch das Brechen von Regeln
– Anders durch das Neuerfinden der Branche oder zumindest durch das Regenerieren der Strategie
Das abstrakte Denken fehlt oft. Neuerungen können nicht aus der Vergangenheit abgeleitet werden. Exploratives Marketing ist notwendig. Keine Weiterrechnung der Vergangenheit, sondern neue Ansätze, die auch mit bestehenden Regeln brechen.
Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass andere Bildungseinrichtungen, andere Organisationen einen ähnlichen Prozess eingehen. Nur den Iststand der Mitbewerber zu überholen ist zu wenig.
Mission
In der Mission, also der Botschaft zur Umsetzung der Vision, dürfte kein wesentlicher Unterschied zwischen den einzelnen Institutionen in Bezug auf E-Learning bestehen. Diese Erkenntnis bezieht sich auf eine internationale Studie. Ein Vergleich unterschiedlicher Länder zeigt, dass die Wichtigkeit für alle gleich wichtig ist:

„The importance of various aspects in the mission statements of the institutions
Throughout the responses, and particularly in terms of the three main conclusions of the study, the differences between the countries are generally minimal, which probably can be explained by the selection of countries. Although sometimes the differences may be statistically significant, the country scores generally cluster quite closely around the overall mean. For example, the figure illustrates how little countries differ with respect to the missions of their higher education institutions. In all countries the mission statements mainly focus on the international students. These differences should not be over-interpreted, however: the overall similarities are more dominant than the between-country differences.“[1]
E-Learning Strategie
Ist die Strategie und die Vision für die Organisation festgelegt, muss diese auf die einzelnen Bereiche umgesetzt werden.
Teilvisionen, Teilstrategien entstehen, die aber der Gesamtausrichtung des Unternehmens untergeordnet sind.
So ist es auch für den Bereich E-Learning notwendig.
Gerade für einen neuen und sich rasch ändernden Bereich wie dem E-Learning ist eine moderne strategische Ausrichtung notwendig.
Sie beeinflusst die Gesamtausrichtung des Bildungsunternehmens mehr als andere Bereiche oder Referate. Eine moderne und ausgezeichnete Buchhaltung ist sicher eine wichtige Einrichtung zur Unternehmensführung, aber moderne Lehrmethoden in einem lehrenden Betrieb haben höheren Stellenwert.
Für die Ausgangslage ist es auch wichtig, genau zu positionieren, wo E-Learning steht und dass es sich um ein zweidimensionales System handelt, das aus Content und Kommunikation besteht:
„E-learning is here seen in terms of two dimensions: Content and communication. Communities of practice use communication for knowledge sharing and co-construction as the richest form of e-learning.“[2]

E-Learning in terms of content and communication with communities of practice representing the intersection of the richest forms of each[3]
Betty Collis kommt in ihrer Studie „Models of Technology and Change in Higher Education“ zur Ansicht, dass 97 Prozent der Bildungsinstitutionen eine IKT-Policy haben:
„The fact that ICT use is common, relates to the policy of the institutions. Respondents indicate 97% of the institutions have a formally stated ICT policy. In 54% of the cases this is a combined bottom-up and top-down type of policy: there is an institutional wide-ICT policy that serves as a framework for faculty-specific plans. In 19% of the cases the policy is bottom-up: faculty or department-levels formulate the ICT policy with no link to the institutional-level decision-making. In only 9% of cases, is the policy characterized as only top-down: an institution-wide policy to be implemented in all faculties. In the remaining cases, respondents were not aware of the nature of the policy (15%) or there was no policy (3%).“[4]
Dies zeigt die Problematik, dass oft eine Fachabteilung, ein Referat, das für eine Untermenge eines Unternehmens zuständig ist, eine nicht abgestimmte oder andere Strategie formuliert als der Rest des Unternehmens.
Im Kapitel „Strategien an österreichischen Universitäten und Fachhochschulen“ gibt die Studie zumindest eine Aufstellung der österreichischen Verhältnisse. Ohne Gewichtung wurde aufgezeigt, wo es eine E-Learning-spezifische Strategie auf der jeweiligen Homepage gibt.
In unseren Nachbarländern ist die Situation ähnlich. Stellvertretend sei hier die Schweiz zitiert: „Ein didaktisches Leitbild, das den Einsatz von eLearning in einen Zielzusammenhang auf Hochschulebene stellt, liegt nur an der Universität St. Gallen im Rahmen der neuen Studienreform vor (Reformstrategie). Dies lässt vermuten, dass es auch auf die besonderen Bedingungen an der Universität St. Gallen, wie z.B. überschaubarer Größe, relative Homogenität, weniger Fakultäten, zurückzuführen ist. An den anderen Hochschulen werden somit die didaktischen Zielsetzungen mit den vorliegenden Strategien auf der Basis von Entwicklungsplänen verknüpft.“[5]